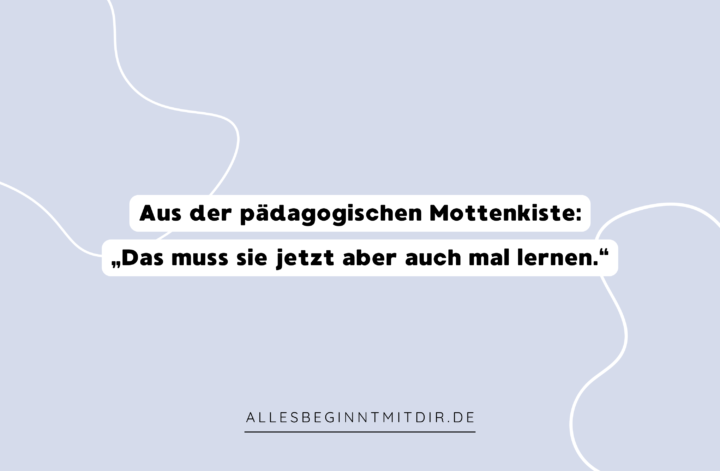Ich war erst wenige Monate mit meinem Studium der Erziehungswissenschaft fertig und blutige Anfängerin im Kindergarten. Die Eingewöhnungen in meiner Kleinkind-Gruppe begannen; meine damalige Kollegin war ein „alter Hase im Geschäft“ und nahm das Heft in die Hand. Die ersten Kinder waren – aus meiner damaligen Wahrnehmung – bereits gut in der Gruppe angekommen und dann kam ein kleines Mädchen zu uns. Noch kein Jahr alt.
Das Mädchen weinte den ganzen Tag. Sie beruhigte sich nur bei direktem Körperkontakt. Getragen auf dem Arm, gekuschelt auf dem Schoß. ― Ich spürte, was das Mädchen brauchte. Und ich war bereit, mich ihr zuzuwenden. (Wobei ich aus heutiger Sicht nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Situation habe.)
Doch meine Ex-Kollegin wollte das nicht: „Du kannst sie nicht die ganze Zeit tragen. Du bist viel zu nah dran. Was willst du denn machen, wenn ich mal nicht da bin und mich um die anderen Kinder kümmere … Und was soll ich denn machen, wenn du nicht da bist? Dann heult sie mir die ganze Zeit die Ohren voll und will auf meinen Arm. Nee, das muss sie jetzt auch mal lernen!!!“ — Ich setzte mich über die Anweisungen meiner damaligen Kollegin hinweg, so gut ich das in dieser Zeit konnte und vor allem dann, wenn meine Kollegin nicht hinsah. Ich spürte, dass ihr Ansatz nicht richtig sein konnte, doch es fehlte mir an fachlichem Hintergrund, an (Berufs-)Erfahrung und vor allem an Haltung, um meinen Standpunkt vertreten und das Mädchen mit all seinen Gefühlen halten zu können.
Ich vermute, die Idee hinter dem Satz meiner Ex-Kollegin ist die folgende: Wenn die Bedürfnisse eines Kindes nur lange genug ignoriert werden, dann verschwinden diese wie von Zauberhand von ganz allein und das Kind wird endlich selbstständig und hängt nicht mehr am Rockzipfel der pädagogischen Fachkraft. Mt einem wohlwollenden Blick könnte ich dieser pädagogischen Fachkraft unterstellen, dass sie tatsächlich an der Entwicklung des Kindes interessiert war und wirklich wollte, dass das Mädchen einen Schritt nach vorn macht. Ich könnte aber auch einfach sagen, dass meiner Ex-Kollegin das Mädchen auf die Nerven ging und sie einfach keine Lust, sich weiter damit zu behängen …
/ Blick in die Bindungsforschung
Dem Bedürfnis nach Bindung steht das Bedürfnis nach Exploration gegenüber. Obwohl diese beiden Bedürfnisse unterschiedlichen Motivationen entspringen, sind sie wechselseitig voneinander abhängig. (Vgl. Brisch 2013, S. 38)
Nach Bindungsforscher John Bowlby kann ein Baby dann ausreichend seine Umwelt erkunden und auch Angst während seiner Entfernung von der Mutter aushalten, wenn er dies von der Mutter als sicherer emotionaler Basis aus tun kann. Eine sichere Bindung ist also eine Voraussetzung dafür, dass ein Baby seine Umwelt erforschen und sich dabei als selbstwirksam erleben kann. (Vgl. Brisch 2013, S. 38-39) Oder anders ausgedrückt: „Wenn die Bindungsbedürfnisse des Kindes befriedigt werden und es bei der Bezugsperson eine emotionale Sicherheit erleben kann, wird das Bindungssystem beruhigt und der Säugling kann seiner Neugier in Form von explorativem Verhalten nachgehen.“ (Brisch 2013, S. 39)
Fabienne Becker-Stoll, Psychologin und Direktorin des Staatsinstitutes für Frühpädagogik, sowie Kathrin Beck und Julia Berkic fassen es so zusammen: „Erst wenn das Kind sich in seiner Bindungsbeziehung sicher fühlt, fängt es an, seine Aufmerksamkeit stärker auf die Umgebung zu richten und sie neugierig zu erkunden. (…) Bindung bietet also nicht nur Schutz, um das Überleben zu sichern, sondern bereitet gleichzeitig auch den Weg dafür, dass Kinder selbstständig werden und alles lernen, was für das Überleben in dieser Umwelt wichtig ist.“ (Becker-Stolle/Beckh/Berkic 2018, S. 17)
„In Wirklichkeit ist nicht Abnabelung,
sondern Bindung der Autonomie-Faktor Nummer Eins.“ (André Stern)
Um es also noch einmal ganz klar zu sagen: Kinder werden nicht dadurch schneller selbstständig, dass Erwachsene aus einer Laune heraus festlegen, „dass sie das jetzt einfach mal lernen müssen“, weil sie ja „schon groß“ sind. Oder dadurch, dass Erwachsene sie „abhärten“ und sie mir ihren Sorgen und Gefühlen von klein auf allein lassen, „weil sie da jetzt eben auch mal durch müssen.“
Das Gegenteil ist der Fall: Damit sich Kinder in den freien Fall der Autonomie begeben können, braucht es einen starken Fallschirm, gewebt aus dem tiefen inneren Gefühl von Sicherheit und Vertrauen darauf, dass ein Erwachsener da sein wird, der sie auffängt.
Kinder haben einen natürlichen, angeborenen Drang, in die Welt zu gehen, diese zu erkunden und zu entdecken. Wenn Fachkräfte Kinder zu schnell in die Autonomie drängen, entsteht für Kinder (Bindungs-)Stress, der sich entwicklungshinderlich auswirkt und damit nicht in eine schnelle Selbstständigkeit führt.
/ Literatur
Becker-Stoll, Fabienne/Beckh, Kathrin/Berkc, Julia (2018): Bindung. Eine sichere Basis fürs Leben. Das große Eltern-Buch für die ersten sechs Jahre. München: Kösel
Brisch, Karl Heinz (2013): Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therape. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag